Dieser Vorwurf ignoriert die komplexen Rahmenbedingungen des modernen Wohnungsbaus. Trotz enormer Herausforderungen leistet die Monheimer Wohnen weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung bezahlbaren und zukunftsgerechten Wohnraums in Monheim am Rhein.
Oft wird übersehen, dass 97 Prozent des Wohnungsbestandes der Monheimer Wohnen aus Neubauwohnungen bestehen. Neubauten sind immer teurer als ältere Gebäude, insbesondere in der aktuellen Marktphase. Die Monheimer Wohnen hat daher bewusst Kosteneinsparungen vorgenommen, die den Wohnkomfort nicht beeinträchtigen – zum Beispiel eine Vereinfachung der Kellerlüftungen, der Kellerbeleuchtung oder Optimierungen der Bodenentsorgung. Es ist aber schlichtweg nicht möglich, eine Neubauwohnung zu den aktuellen Kosten zu errichten und die gleiche Miete wie für jahrzehntealte Wohnungen anzusetzen.
Alle neuen Wohneinheiten sind in einer Zeit entstanden, die geprägt ist von stark gestiegenen Baukosten, Zinsen und regulatorischen Anforderungen wie komplexen Bauvorschriften und energetischen Anforderungen. So haben sich Finanzierungskosten im Vergleich zwischen dem Wohnquartier Unter den Linden, das 2021 während der Coronazeit fertig gestellt wurde, und dem Sophie-Scholl-Quartier, das unter dem Eindruck der Coronazeit und dem Krieg in der Ukraine gebaut wurde, nahezu verdoppelt. Im Wohnquartier Unter den Linden konnte die Monheimer Wohnen im September 2021 noch Kaltmieten von 6,20 €/m² bis maximal 10 €/m² anbieten. Diese Mieten lagen zu dieser Zeit bereits rund 20 Prozent unter dem marktüblichen Neubaumietniveau.
Bis August 2025 hat die Monheimer Wohnen insgesamt 465 neue Wohnungen in Monheim am Rhein gebaut. Die Neubauobjekte sind sehr zukunftsfähig, barrierefrei, bewegen sich in den besten Energieeffizienzklassen A und B und bieten einen breiten Wohnungsmix sowie ausreichend Kfz- und Fahrradstellplätze. Die Kaltmieten für die 1,5 bis 5-Zimmerwohnungen bewegen sich aktuell, je nach Baujahr und Ausstattung, zwischen 6,27 €/m² und 13,90 €/m². Folglich richtet sich das Angebot an die verschiedensten Wohnungssuchenden. Allein 129 der 465 Wohnungen sind öffentlich gefördert – rund 28 Prozent des Bestandes. Diese Wohnungen werden zu deutlich unter dem Marktniveau liegenden Mieten, zum Beispiel aktuell 6,61 €/m² im Sophie-Scholl-Quartier und 6,27 €/m² im Wohnquartier Unter den Linden angeboten und sind Menschen mit geringerem Einkommen vorbehalten. Ohne die Monheimer Wohnen GmbH und ihre Investitionen in diesen Bereich gäbe es diesen dringend benötigten, tatsächlich günstigen Wohnraum in Monheim am Rhein nicht. Die Mischkalkulation der Gesamtprojekte, in der auch die frei finanzierten Wohnungen einen Teil der Kosten der geförderten Wohnungen mittragen müssen, ist dabei ein fester Bestandteil des Geschäftsmodells.
Monheim am Rhein ist beliebt, besonders bei Menschen aus den umliegenden Städten. Der Großteil der Wohnungen der Monheimer Wohnen wird aber gezielt an Monheimerinnen und Monheimer vermietet. So beeinflusst die Monheimer Wohnen die Miethöhen im Stadtgebiet erfolgt direkt und indirekt: Wenn Monheimerinnen und Monheimer in neue Objekte einziehen, werden auch wieder Wohnungen in günstigeren Bestandsgebäuden im Stadtgebiet frei. Dass dieser Faktor möglicherweise nicht für jede und jeden spürbar ist, liegt an dem nach wie vor sehr hohen Wohnungsdruck.


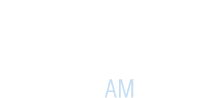






![E-Mail Link [E-Mail]](https://www.monheim.de/typo3conf/ext/website_template/Resources/Public//Images/mail-link.png)
![interner Link [intern]](https://www.monheim.de/typo3conf/ext/website_template/Resources/Public//Images/internal-link.png)


